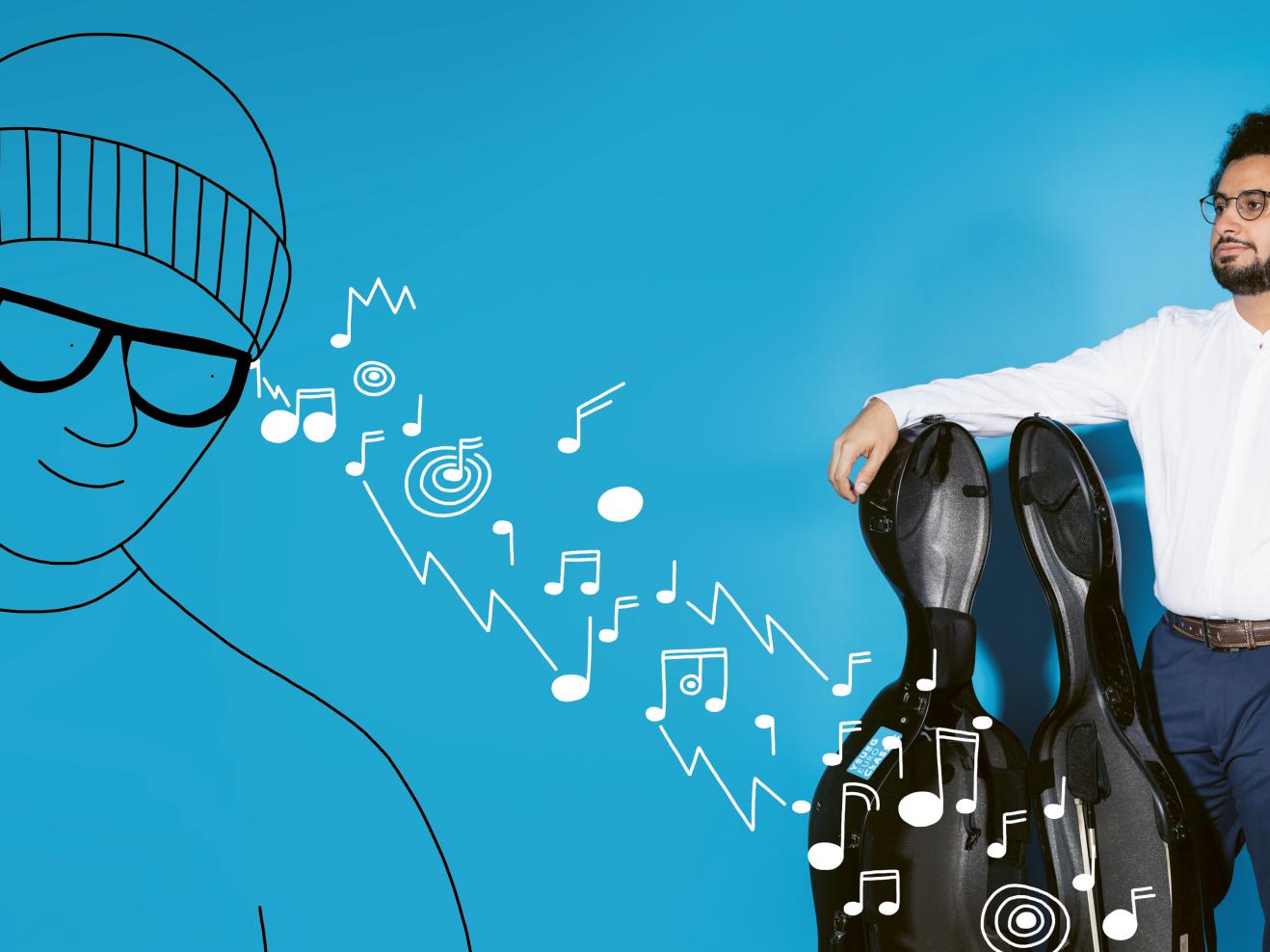Im Zentrum von Kooperationen stehen Freundschaften
Als Direktorin der Akademie Schloss Solitude ist Anne Fleckstein Ermöglicherin und Brückenbauerin, die Künstler*innen und Wissenschaftler*innen freie Arbeitsbedingungen schafft und internationale Vernetzung in die Region fördert. Mit Florian Hölscher, Klavierprofessor an der HfMDK, hat sie über ihre langjährige Erfahrung in der transkulturellen Zusammenarbeit, speziell im Bereich künstlerischer Beziehungen in den globalen Süden, gesprochen.
DOKUMENTATION: GISELA THOMAS KULTURAGENTUR
Florian Hölscher: Gibt es bei den Kooperationsländern von Solitude stabile Achsen oder ist die Zusammenstellung der Herkunftsländer jedes Mal anders?
Anne Fleckstein: Über die Jahre haben sich die Verbindungen immer wieder verändert. Aus Deutschland erhalten wir konstant viele Bewerbungen, dicht gefolgt von den USA und zunehmend südamerikanischen Ländern, Südasien und einzelnen afrikanischen Ländern. Die bestehenden Achsen bilden und festigen sich über die Fellows und über die internationalen Jurymitglieder. Sie berichten über ihre Fellowships bzw. streuen die Ausschreibung in ihren jeweiligen Netzwerken. Neben den regulären Ausschreibungen gibt es auch gezielt inhaltliche und geografische Schwerpunkte, zum Beispiel in unserem Osteuropa-Netzwerk, wo wir explizit den Austausch mit Partnerinstitutionen aus dieser Region fördern.
Spüren Sie einen besonderen Zulauf aus Ländern, in denen Kunstfreiheit nicht existiert oder in Gefahr ist?
Uns erreichen sehr viele Anfragen aus Ländern, die autokratisch regiert werden. Vor allem Künstlerinnen haben mancherorts wenig Möglichkeiten zu arbeiten – sei es aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen. Kulturschaffende speziell aus Kriegsgebieten haben oft keine Möglichkeit, ihrer Kunst nachzugehen, geschweige denn davon zu leben. Diese Gelegenheit haben sie während ihres Aufenthalts auf Solitude.
Was würden Sie als Ermöglicherin von künstlerischer Zusammenarbeit und kulturellem Austausch sagen: Was sind Chancen eines interdisziplinären Austausches bzw. wo liegt der Reiz, die Grenzen zu anderen Disziplinen zu ignorieren?
Das Besondere liegt darin, dass Künstler*innen und Wissenschaftler*innen neue Ausdrucksmöglichkeiten und Perspektiven entdecken und ein Dialog zwischen den Praxisfeldern aber auch zwischen Forschung und künstlerischer Praxis entsteht. Das kann man bei unseren Fellows beobachten. Man muss auch betonen, dass besonders in Europa stark zwischen Disziplinen unterschieden wird, während z. B. afrikanische Kulturschaffende die Grenzen fließender verstehen.
Gibt es bei Ihnen im Haus Diskussionen darüber, was interdisziplinäre Zusammenarbeit für die künstlerische Ausbildung in einzelnen Disziplinen bedeutet?
Eine kritische Frage besonders von außereuropäischen Kulturschaffenden lautet: Wer legt eigentlich fest, was künstlerische Qualität ist und auch was eine Disziplin ist? Das Jonglieren zwischen verschiedenen Techniken kann eine enorme Wirkungskraft entfalten.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist von interkulturellem bzw. transkulturellem Austausch kaum zu trennen – in Ihrer Institution und wahrscheinlich auch an der HfMDK. Denken Sie, dass die Globalisierung und die Verfügbarmachung von Informationen durch das Internet diese Neugierde auf Begegnung verändert haben?
Ich kann verschiedene Aspekte beobachten: Junge Künstler*innen und Forschende sind von vornherein schnell aufgefordert, sich ein Profil zu geben. Man kann sich nicht so viele Unsicherheiten und Zweifel erlauben, die aber besonders wichtig im Vorankommen sind. Dieser Druck lastet sehr stark auf allen und verändert die Kunst. Das andere ist, dass die Fellows, die zu uns kommen, durch die sozialen Medien oft Bilder im Kopf haben, was sie in Stuttgart erwartet. Das kann sie davon abhalten, Begegnungen zu suchen, kann sie aber auch neugierig machen auf Dinge, von denen sie gehört haben. Es beeinflusst auf jeden Fall das Ankommen hier und wie sie sich im neuen Umfeld orientieren.
Gibt es bei Kulturförderprogrammen, die auf Begegnungen setzen, äußere Faktoren, die den Austausch beeinflussen können?
Ich betrachte Residenzen als zentrale Orte, um überhaupt die Möglichkeit von Verbindungen über Grenzen hinweg zu verhandeln. Hier wird Zusammenleben erprobt, mit allen Spannungen, Widersprüchen, die es in der Gesellschaft und in der Welt gibt. Leute kommen mit unterschiedlichen Rollenverständnissen und politischen Haltungen … da tauchen auch Friktionen auf. Dass das in der Gemeinschaft ausgehandelt wird, erfordert Verständigung, Kommunikation, die Bereitschaft zuzuhören – Kompetenzen und Fähigkeiten, die, so entsteht der Eindruck, in der heutigen Medienlandschaft oft vernachlässigt werden. Äußere Faktoren wie Machtstrukturen spielen selbstverständlich auch eine Rolle, weil sich viele Kulturschaffende inzwischen als explizit machtkritisch in ihrer Praxis verstehen. Das führt auch dazu, dass wir uns als Einrichtung verändern, uns hinterfragen und stärker in den Austausch gehen. Wie viele Kulturinstitutionen begreifen wir uns als eine lernende Einrichtung.
Wie gehen Sie mit Machtasymmetrien und Erwartungshaltungen um, die bei der Vergabe von Stipendien mit deutschen Steuergeldern und Geldern aus der Wirtschaft an Künstler*innen aus dem In- und Ausland im Raum stehen?
Wir sind zum größten Teil von der öffentlichen Hand gefördert. Die Spannung, die entsteht, wenn eine ressourcenreiche Institution Menschen aus ressourcenärmeren Regionen fördert, muss sichtbar gemacht werden. Wichtig ist Transparenz über die Förderung. Wen und was genau unterstützen wir? Was gehört zu unserem Auftrag, was nicht? Wo kommen die Gelder her, welche Erwartungen sind daran geknüpft? Welche Erwartungen werden an die Institution oder an die Fellows weitergegeben? Welche Erwartungen haben die Fellows an uns? Transparenz beseitigt zwar keine Machtasymmetrien, aber sie ist ein erster Schritt.
Haben Sie den Eindruck, dass aktuelle Uneinigkeiten die Neugierde oder Freude an der Zusammenarbeit beeinflussen oder sogar bremsen?
Die Fellows bei uns sind extrem motiviert, miteinander zu arbeiten. Das funktioniert fantastisch! Grundsätzlich haben sie große Lust, mit Kooperationspartner*innen in Stuttgart und in ganz Deutschland zusammenzuarbeiten. Voraussetzung dafür ist ein persönlicher Kontakt und eine Vertrauensebene. Oft heißt es, man arbeite mit einer Einrichtung. Auf der Arbeitsebene kommen da aber Menschen zusammen, die sich gut verständigen müssen, und das ist auf der internationalen Ebene besonders wichtig. Tatsächlich stehen im Zentrum von langjährigen Kooperationen Freundschaften. Eine interkulturelle, transdisziplinäre Kooperation ist immer Beziehungsarbeit. In Zeiten starker Polarisierungen und stereotyper Vorannahmen sind persönliche Begegnungen und Beziehungen umso wichtiger. Denn wenn ein Dialog entsteht und ein Perspektivwechsel stattfindet, ist aus meiner Sicht alles offen. Diese Verbindungen geben mir Hoffnung, dass Verständigung möglich ist. Dieses auf den Einzelnen ausgerichtete Engagement hat eine – zunächst kaum sichtbare – multiplikatorische Wirkung, es wirkt über die Kooperation hinaus. Auf diese Art und Weise ist auch das Netzwerk von Solitude gewachsen.
Haben Sie beobachtet, dass in der Zusammenarbeit von zwei oder mehr Künstler*innen Fragen der Urheberschaft und der uneingeschränkten Verantwortung dem Kunstwerk gegenüber den Schöpfungsprozess negativ oder positiv beeinflussen können?
Ob negativ oder positiv – jedenfalls beeinflussen sie ihn. Gerade wenn man an die digitalen Künste denkt, sind Fragen der Urheberschaft Bestandteil des Schaffensprozesses. Wem stelle ich eigentlich was zur Verfügung und setze ich mich mit Open Source auseinander? Diese Fragen werden also möglicherweise bereits Bestandteil der künstlerischen Strategie. Das zeigt sich auch in anderen Entwicklungen der zeitgenössischen Kunst und in interdisziplinären Projekten. Bei uns wird zum Beispiel nicht mehr in Sparten, sondern in Praxisfeldern gedacht. Eines dieser Praxisfelder heißt „Gesellschaftlich/Gemeinschaftlich.“ Hier werden Künstler*innen gefördert, die ihr eigenes Schaffen explizit in der Vermittlung und in der engen Verzahnung mit gesellschaftlichen Prozessen sehen. Da kann Urheberschaft nicht immer klar zugeordnet werden, denn das Kunstwerk entsteht in der Auseinandersetzung mit der Gemeinschaft. Das ist ein anderes künstlerisches Selbstverständnis. Ich habe insgesamt beobachtet, dass gesellschaftspolitische Fragestellungen einen sehr großen Raum einnehmen. Dabei spielen auch Fragen zu Produktionsbedingungen eine wichtige Rolle: Wie wird eigentlich Kunst geschaffen? Welche Bedingungen bringen manche Menschen mit und manche nicht? All das beeinflusst ein künstlerisches Werk und ganz besonders, wenn sich Künstler*innen aus unterschiedlichen Zusammenhängen begegnen. Wirkliche Kooperation findet oft vor allem auf einer künstlerischen Ebene statt, insbesondere in der Musik. Das konnte ich auch in Projekten in meiner vorherigen Tätigkeit beobachten. Gerade da, wo man sich nur schwer verständigen kann, sei es sprachlich oder durch unterschiedliche musikalische Traditionen, wo eine Verständigung über Codes nicht möglich ist – die einen spielen von Noten, die anderen improvisieren frei – in dem Moment, wo zusammen musiziert wird, entsteht plötzlich etwas. Diese Art der Verständigung ist sehr beeindruckend.
Wenn man die Praktiken der jeweils anderen Kultur übernimmt, kann das auf der Bühne gelingen, es wird aber auch vielfach kritisiert. Haben Sie mit einem solchen Aufeinanderprallen von kulturellen Implikationen und Assoziationen Erfahrungen gemacht?
Wichtig ist, dass es diese Kritik gibt, und dass sie auch geäußert wird. Dass gefragt wird, ob und warum man Dinge in dem Kontext belassen sollte, in dem wir ihn rezipieren, was eigentlich kulturelle Appropriation sein kann, oder ob man auch spielerisch damit umgehen darf. Meine Einschätzung ist, dass es entscheidend ist, wie reflektiert und selbstkritisch man in eine Begegnung hineingeht und ob man Dissens und Konflikt zulässt. Diese Spannung auszuhalten, das Hinterfragen, die Selbstkritik und -reflexion ist meiner Meinung nach in einer Zusammenarbeit Teil des künstlerischen Gesamtprozesses.
Ein Dreiklang aus Neugier, Respekt und kritischer Auseinandersetzung, die einen auch durch unsichere Aspekte der Begegnung leiten können.
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, Unsicherheiten sichtbar zu machen. Niemand kann sich sicher sein. Die Dinge verändern sich so schnell, dass, was man gestern als gesichert angesehen hat, morgen schon wieder inaktuell sein kann. Und wenn es um Perspektiven aus anderen kulturellen Kontexten geht, muss man möglicherweise sein Wissen über Bord werfen, neue Fragen stellen und vor allem sehr gut zuhören, um zu verstehen. Aber das ist meine sehr persönliche Erfahrung.
Im Zweifelsfall eine Frage mehr stellen als eine Behauptung in den Raum werfen.
Ich möchte lieber als naiv und unwissend, aber neugierig wahrgenommen werden als anmaßend.
Anne Fleckstein
Die promovierte Kulturwissenschaftlerin Anne Fleckstein ist seit 2024 Direktorin der Akademie Schloss Solitude in Stuttgart. Von 2015 bis 2023 leitete sie bei der Kulturstiftung des Bundes das Programm TURN für künstlerische Kooperationen zwischen Deutschland und afrikanischen Ländern. Zuvor war sie als Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle sowie für die Französische Botschaft und das Goethe-Institut tätig.